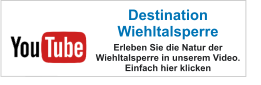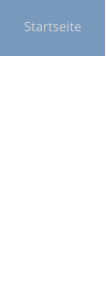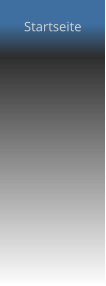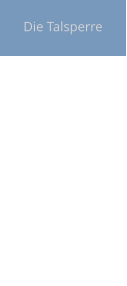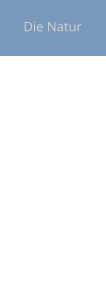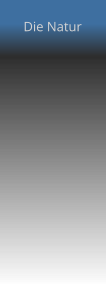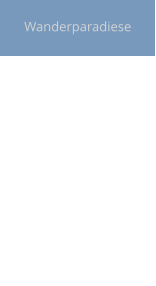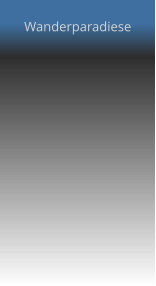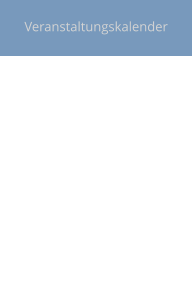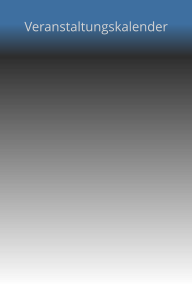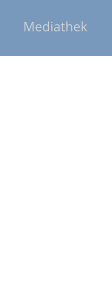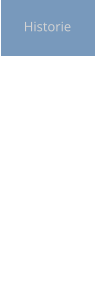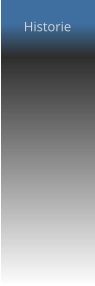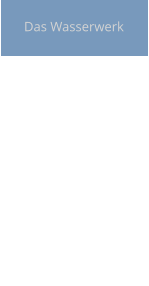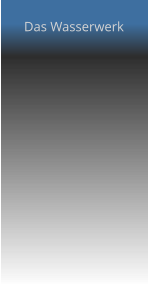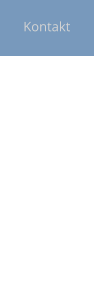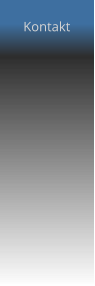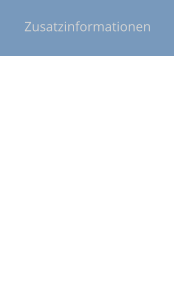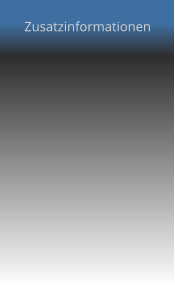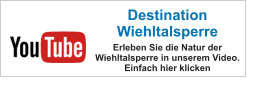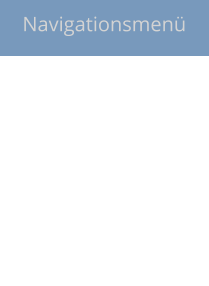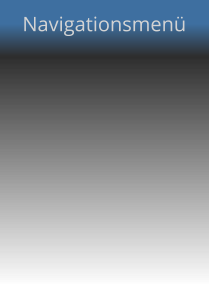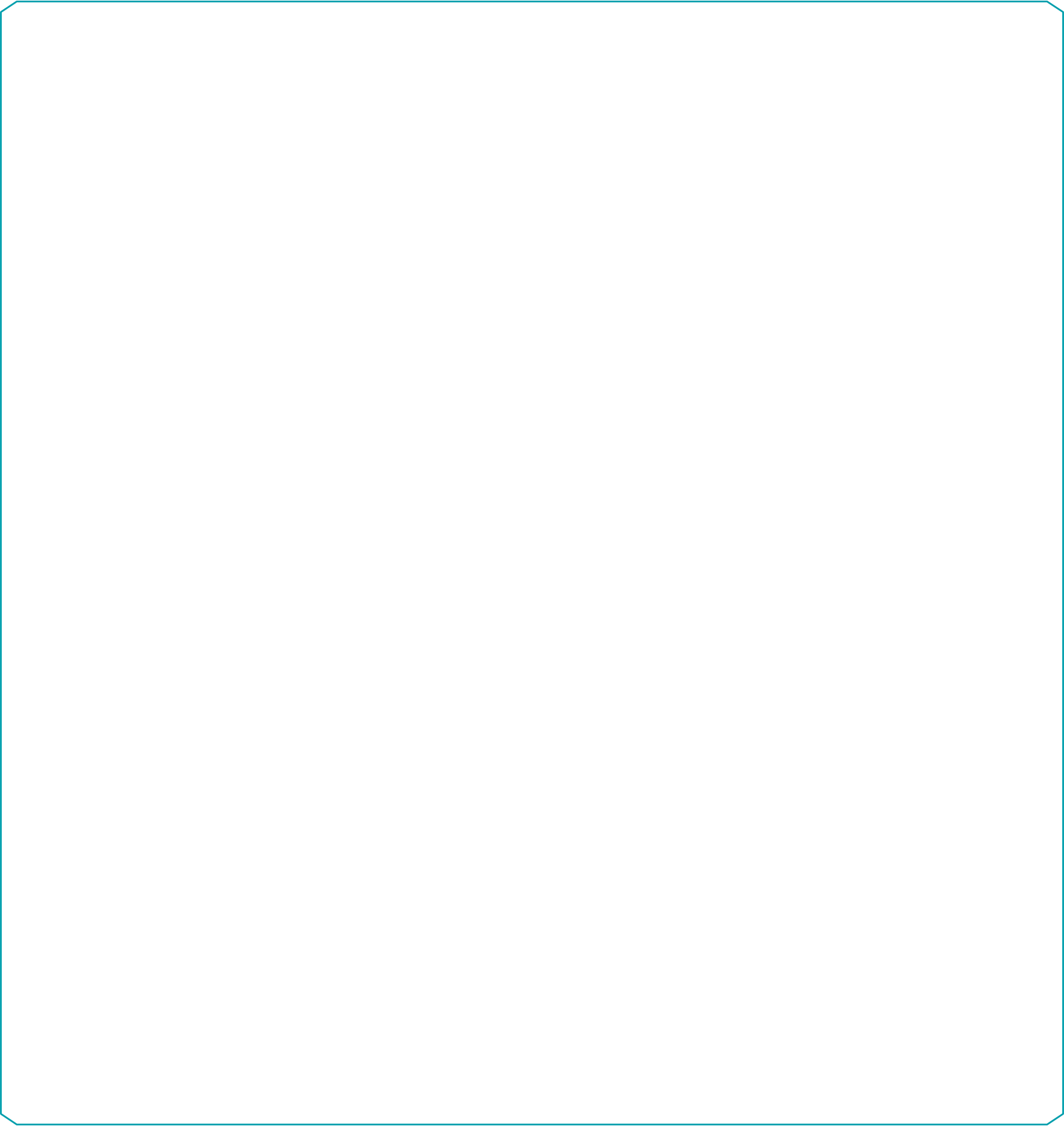
Die Geschichte der Wiehltalsperre
Die Entstehungsgeschichte der heutigen Wiehltalsperre liegt mehr als 100 Jahre zurück.
Es war im Jahr 1923 als man sich dazu entschloss eine Institution zu Gründen die sich mit der Thematik der
ausreichenden Trinkwasserversorgung im Oberbergischen Land beschäftigte. So wurde dann am
12.12.1923 die Aggertalsperren-Genossenschaft gegründet .Diese Institution nannte sich zur damaligen Zeit
" Aggertalsperren-Genossenschaft "
Diese damalige " Aggertalsperren-Genossenschaft " kam dann sehr schnell zu dem Entschluss, dass es von
größter Bedeutung sei eine Talsperre im Gebiet des Flusses Wiehl zu errichteten , um den steigenden
Trinkwasserbedarf in der Region auf lange Dauer zu sichern.
Die damaligen Pläne sahen vor eine Sperrmauer oberhalb der Biebersteiner-Mühle nahe der Stadt Wiehl zu errichten um von dort aus das Wasser
Tal aufwärts zu Stauen. Jedoch waren die damaligen finanziellen Mittel erheblich zu klein um ein solches Großprojekt zu verwirklichen.
Um 1934 gingen die Überlegungen dahin, eine Talsperre oberhalb der Ortschaft Wildbergerhütte zu errichten. Aber auf Grund der Tatsache dass
sich die so genannte Aggertalgenossenschaft (die sich ebenfalls am Bau der Aggertalsperre beteiligt hatte) noch immer nicht die genügenden
finanziellen Mittel aufbringen konnte, waren diese Pläne dann schnell wieder vom Tisch.
So entschloss man sich dazu, erst einmal einen kleineren Ausgleichsweiher in der Nähe der Ortschaft im Bieberstein zu errichten. Dieser
Ausgleichsweiher wurde im Jahre 1937 fertig gestellt.
Im April 1943 schloss sich die Aggertalgenossenschaft mit anderen Interessengemeinschaften der Wasserbauwirtschaft zusammen und gründeten
den heutigen Aggerverband.
Erst Mitte der sechziger Jahre waren die finanziellen Mittel umfangreich genug um sich wieder dem Projekt Wiehltalsperre an zu nehmen.
Man entschloss sich nun dazu eine Talsperre unterhalb der Ortschaft Wildbergerhütte zu errichten. Im Jahr 1966 begann man mit dem Ankauf der
benötigten Flächen zum Bau der Wiehltalsperre. Es mussten über 700 ha Land
erworben werden.
Dieser Ankauf erwies sich als äußerst schwierig und politisch brisant, da sich in diesem Gebiet
11 Ortschaften befanden.
Es waren die Ortschaften :
Auchel, Berg, Dresbach, Finkenrath, Hohl, Jägerhaus ,Kühlbach, Niederodenspiel, Nothausen, Sprenklingen, Ufersmühle.
Bewohner dieser Ortschaften wehrten sich verständlicherweise massiv gegen dieses Projekt der Wiehltalsperre. In vielen Gerichtsprozessen und
etlichen politischen Auseinandersetzungen verloren die Bewohner dieser Ortschaften letztendlich ihr Recht auf das Fortbestehen ihrer Dörfer.
Doch was sich für
uns alle als großer Nutzen darstellt, bedeutete für die Bewohner des Talsperrengebietes Aufgabe ihres alten Lebensraumes. Die Stätte ihrer
Jugend und schöner Erinnerungen mußte hergegeben werden, alte Nachbarschaftsbande mußten gelöst werden. Dies sollte nicht vergessen
werden .
1967 wurde mit dem Bau der Talsperre begonnen. Die Bauarbeiten waren dann im Jahre 1973 abgeschlossen und man konnte dazu übergehen,
das Wasser oberhalb der Hauptsperrmauer auf zu Stauen um kurz darauf den Betrieb der Trinkwassergewinnung aufzunehmen .
Die heutige Staufläche ( Wasserfläche ) beträgt je nach Wasserstand ca. 200 ha. Das Wasservolumen beträgt mehr als 30 Millionen Kubikmeter.
das komplette Einzugsgebiet dieser Trinkwasser Talsperre erstreckt sich auf ca. 46 Quadratkilometer .





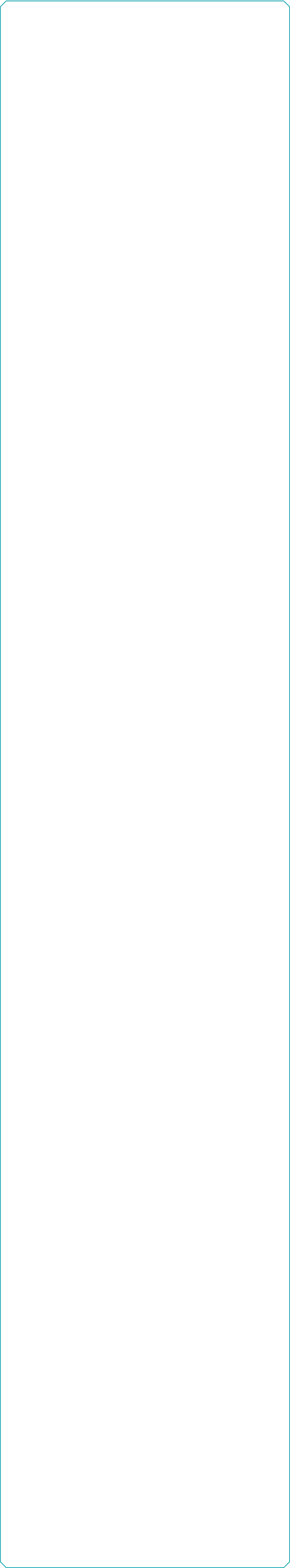
Die Geschichte der Wiehltalsperre
Die Entstehungsgeschichte der heutigen Wiehltalsperre
liegt mehr als 100 Jahre
zurück.
Es war im Jahr 1923 als
man sich dazu entschloss
eine Institution zu Gründen
die sich mit der Thematik der ausreichenden
Trinkwasserversorgung im Oberbergischen Land
beschäftigte. So wurde dann am 12.12.1923 die
Aggertalsperren-Genossenschaft gegründet .Diese
Institution nannte sich zur damaligen Zeit "
Aggertalsperren-Genossenschaft "
Diese damalige " Aggertalsperren-Genossenschaft " kam
dann sehr schnell zu dem Entschluss, dass es von
größter Bedeutung sei eine Talsperre im Gebiet des
Flusses Wiehl zu errichteten , um den steigenden
Trinkwasserbedarf in der Region auf lange Dauer zu
sichern.
Diese damalige " Aggertalsperren-Genossenschaft "
kam dann sehr schnell zu dem Entschluss, dass es von
größter Bedeutung sei eine Talsperre im Gebiet des
Flusses Wiehl zu errichteten , um den steigenden
Trinkwasserbedarf in der Region auf lange Dauer zu
sichern.
Die damaligen Pläne sahen vor eine Sperrmauer
oberhalb der Biebersteiner-Mühle nahe der Stadt Wiehl
zu errichten um von dort aus das Wasser Tal aufwärts zu
Stauen. Jedoch waren die damaligen finanziellen Mittel
erheblich zu klein um ein solches Großprojekt zu
verwirklichen.
Um 1934 gingen die Überlegungen dahin, eine Talsperre
oberhalb der Ortschaft Wildbergerhütte zu errichten. Aber
auf Grund der Tatsache dass sich die so genannte
Aggertalgenossenschaft (die sich ebenfalls am Bau der
Aggertalsperre beteiligt hatte) noch immer nicht die
genügenden finanziellen Mittel aufbringen konnte, waren
diese Pläne dann schnell wieder vom Tisch.
So entschloss man sich dazu, erst einmal einen kleineren
Ausgleichsweiher in der Nähe der Ortschaft im
Bieberstein zu errichten. Dieser Ausgleichsweiher wurde
im Jahre 1937 fertig gestellt.
Im April 1943 schloss sich die Aggertalgenossenschaft mit
anderen Interessengemeinschaften der
Wasserbauwirtschaft zusammen und gründeten den
heutigen Aggerverband.
Erst Mitte der sechziger Jahre waren die finanziellen
Mittel umfangreich genug um sich wieder dem Projekt
Wiehltalsperre an zu nehmen.
Man entschloss sich nun dazu eine Talsperre unterhalb
der Ortschaft Wildbergerhütte zu errichten. Im Jahr 1966
begann man mit dem Ankauf der benötigten Flächen zum
Bau der Wiehltalsperre. Es mussten über 700 ha Land
erworben werden.
Dieser Ankauf
erwies sich als
äußerst
schwierig und
politisch brisant, da sich in diesem Gebiet
11 Ortschaften befanden.
Es waren die Ortschaften :
Nothausen, Jägerhaus, Niederodenspiel, Hohl,
Sprenklingen, Ufersmühle, Auchel, Berg, Finkenrath,
Dresbach und Kühlbach.
Die Bewohner dieser Ortschaften wehrten sich
verständlicherweise massiv gegen dieses Projekt der
Wiehltalsperre. In vielen Gerichtsprozessen und etlichen
politischen Auseinandersetzungen verloren die Bewohner
dieser Ortschaften letztendlich ihr Recht auf das
Fortbestehen ihrer Dörfer.
Doch was sich für
uns alle als großer Nutzen darstellt, bedeutete für die
Bewohner des Talsperrengebietes Aufgabe ihres alten
Lebensraumes. Die Stätte ihrer Jugend und schöner
Erinnerungen mußte hergegeben werden, alte
Nachbarschaftsbande mußten gelöst werden. Dies sollte
nicht vergessen werden .
1967 wurde mit dem Bau der Talsperre begonnen. Die
Bauarbeiten waren dann im Jahre 1973 abgeschlossen
und man konnte dazu übergehen, das Wasser oberhalb
der Hauptsperrmauer auf zu Stauen um kurz darauf den
Betrieb der Trinkwassergewinnung aufzunehmen .
Die heutige Staufläche ( Wasserfläche ) beträgt je nach
Wasserstand ca. 200 ha. Das Wasservolumen beträgt
mehr als 30 Millionen Kubikmeter. das komplette
Einzugsgebiet dieser Trinkwasser Talsperre erstreckt sich
auf ca. 46 Quadratkilometer .